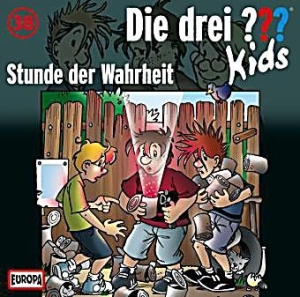In Deutschland mussten bislang ausschließlich Mieter die CO₂-Abgabe auf Heizkosten tragen. Durch das Brennstoffemissionshandelsgesetz und das Europäische Emissionshandelssystem (ETS) wurden die Kosten komplett an sie weitergereicht. Die Abgabe betrug 30 Euro pro Tonne für Öl oder Gas und steigt 2024 auf 35 Euro pro Tonne. Einsparungen waren der einzige Weg, diese zu reduzieren.
2022 nutzten rund 70% der bayerischen Haushalte Gas oder Öl zum Heizen. Die Kombination aus hohen Energiepreisen und CO₂-Abgabe regte Mieter zum sparsamen Heizen an. Vermieter hingegen sahen wenig Anreiz, in klimafreundliche Renovierungen zu investieren. Das CO₂-Kostenaufteilungsgesetz soll dies nun ändern.
Die Aufteilung der CO₂-Kosten basiert auf einem Stufenmodell des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz. Je höher der Emissionswert eines Gebäudes, desto mehr tragen die Vermieter. Das Gesetz ist bereits in Kraft, wird aber erst mit der Heizkostenabrechnung 2024 angewendet.
Die CO₂-Abgabe orientiert sich an Brennstoff, Verbrauch und Wohnfläche und wird zwischen Vermietern und Mietern aufgeteilt. Sie muss in den Heizkostenabrechnungen aufgeführt werden. Ein Online-Rechner der Regierung unterstützt Mieter bei der Kostenkontrolle.
Das Gesetz entlastet Mieter in schlecht isolierten Immobilien, während Vermieter tiefer in die Tasche greifen müssen. Es fördert das Energiesparen.
Ausnahmen wie bei denkmalgeschützten Gebäuden oder bei Anschluss an ein Fernwärmenetz werden gleichmäßig aufgeteilt. Für Gewerbeimmobilien sind spezielle Regelungen geplant.
Obwohl energetische Modernisierungen unterstützt werden, sind die Entlastungen bei den Heizkosten begrenzt. Mieter können die CO₂-Abgabe um 3% reduzieren, wenn sie nicht ausgewiesen wird. Ein Dialog mit den Vermietern kann hier hilfreich sein.
Der Beitrag Vermieter heranziehen erschien zuerst auf Mehrwert Zeitung.